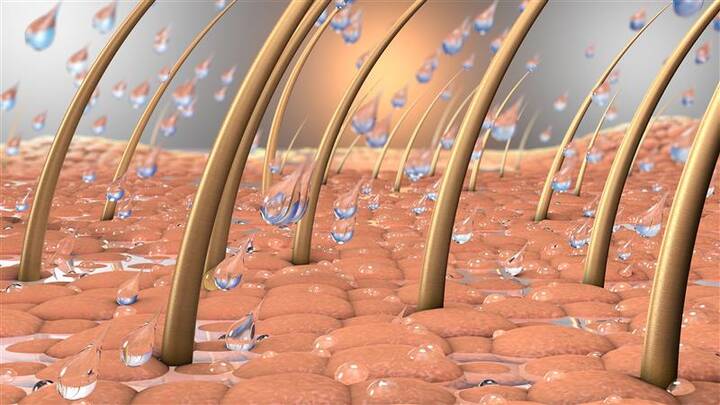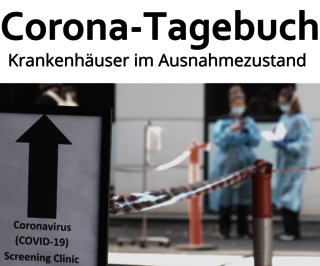Inkontinenz-assoziierte Dermatitis wird häufig mit Dekubitus verwechselt – ein fataler Irrtum mit schwerwiegenden Folgen. Fachtherapeutin Wunde ICW Dorothea Hentschel erläutert im Interview Ursachen, Präventionsmaßnahmen und die effektivsten Behandlungsstrategien, die Pflegefachpersonen kennen sollten.
Was genau ist unter einer inkontinenz-assoziierten Dermatitis, kurz IAD, zu verstehen und wie unterscheidet sie sich von anderen Hauterkrankungen wie Dekubitus?
Bei der IAD handelt es sich um eine durch Feuchtigkeit verursachte entzündliche Hautschädigung im perianalen Bereich, die durch Stuhl- und/oder Urininkontinenz ausgelöst wird. Das Hauptproblem besteht darin, dass eine IAD häufig mit einem Dekubitus verwechselt wird. Die Prävalenzangaben der IAD in deutschen Kliniken sind unterschiedlich und werden teilweise auf bis zu 50 Prozent geschätzt.
Welche Hauptursachen und Risikofaktoren begünstigen die Entstehung einer IAD?
Diese Schädigung entwickelt sich auf Grundlage mehrerer schädigender Faktoren und ist stets das Ergebnis einer "Top-down-Wirkung" schädigender Noxen auf die Haut. Ich sehe den flüssigen Stuhl als Hauptverursacher an. Je flüssiger der Stuhl ist, desto höher ist die Gefahr für die Patientenhaut. Flüssiger Stuhl breitet sich nicht nur großflächiger im perianalen Bereich aus, sondern enthält auch erheblich mehr kristalline Substanzen und Säuren. Medikamente wie Antibiotika, Immunsuppressiva und Katecholamine machen die Ausscheidungen zusätzlich aggressiver. Eine Stuhlinkontinenz birgt zudem ein höheres Risiko für eine IAD als eine Urininkontinenz. Leidet die Patientin oder der Patient unter einer Kombination aus beiden Inkontinenzformen, kann das Zusammentreffen von flüssigem Stuhl und Urin zu erheblichen Problemen führen. Am besten lässt sich das am "Ziegelstein-Mörtel-Prinzip" (1) erklären: Normalerweise besteht unsere Hautbarriere aus einem festen Verbund von Hornzellen und Lipiden. Die Lipide fungieren dabei wie Mörtel und halten die Mauer stabil. Trifft zu viel Feuchtigkeit auf diese Barriere, werden die Lipide gelöst. Dadurch wird die Hautbarriere instabil und es entsteht eine ideale Eintrittspforte für alle Schadstoffe. Durch die Umwandlung von Harnstoff in Ammoniak werden die Stuhlenzyme aktiviert. Diese spalten Eiweiße und Fette und greifen das Stratum corneum an. Zusätzlich führt die Proteasen-Aktivität zu einer Erhöhung des pH-Werts der Haut. Folglich ist die Haut vermehrt Bakterien und Mikroorganismen ausgesetzt. Zusätzliche Risiken erhöhen zudem die Gefahr, eine IAD zu erwerben. Besonders betroffen sind Patientinnen und Patienten mit intrinsischer Haut. Die sogenannte Altershaut ist häufig pergamentartig dünn. Durch die reduzierte Talg- und Schweißproduktion wird sie trocken. Die Barrierefunktion ist rückläufig. Der reduzierte Turgor führt zur Faltenbildung und die Wundheilung ist verlangsamt. Häufig kommt noch eine verminderte Hautwahrnehmung hinzu.

Welche präventiven Maßnahmen können Pflegefachpersonen ergreifen, um das Risiko einer IAD bei inkontinenten Patientinnen und Patienten zu minimieren?
Wenn die Pflegefachperson das IAD-Risiko – im Unterschied zum Dekubitus – erkannt hat, ist jetzt präventiv vorzugehen. Wir arbeiten an dieser Stelle mit dem „Inkontinenz-assoziierten Interventionstool“, kurz IADIT-D (1). Mithilfe dieses Tools können Anwenderinnen und Anwender nicht nur das Risiko erfassen, sondern anhand von Bildern auch das Ausmaß einer IAD einschätzen. Hilfreich sind bei diesem Tool außerdem die Interventionsvorschläge. Der Hautzustand ist dabei in regelmäßigen Abständen zu begutachten. Ich empfehle jeder Einrichtung, einen für sie realistischen und individuellen Standard zu erstellen. Dieser sollte Risikoeinschätzung, Prävention und Therapie einer IAD beinhalten. Somit wird der Handlungsrahmen für Pflegefachpersonen genau definiert, innerhalb dessen die individuelle Pflege erfolgen soll. Für unsere Häuser habe ich bereits vor Jahren einen entsprechenden Standard eingeführt. Dabei habe ich mich am bereits erwähnten IADIT-D orientiert und für jedes IAD-Stadium die notwendigen Interventionen für unsere Klinik festgelegt. Dadurch werden Unsicherheiten minimiert, und den Mitarbeitenden stehen die entsprechenden Materialien zur Verfügung. Die Pflegefachpersonen wurden entsprechend geschult und sind mit den einsetzbaren Materialien vertraut. Selbstverständlich steht über allen einzuleitenden Interventionen die Ursachenminimierung. Die Behandlung der Inkontinenz hat höchste Priorität! Parallel dazu ist alles zu tun, um die perianale Haut zu schützen. Pflegefachpersonen sollten das Inkontinenzmaterial prüfen. Gute Produkte zeichnen sich durch eine hohe Aufnahmekapazität und den Einschluss von Feuchtigkeit aus. Besonders empfehlenswert sind citratgepufferte Materialien, da sie den schädlichen Ammoniak bereits im Produkt eliminieren.
Wie gestaltet sich die optimale Wundversorgung bei Patientinnen und Patienten mit IAD, und welche Produkte oder Techniken haben sich dabei als besonders effektiv erwiesen?
Alle Inkontinenzbetroffenen sollten vorbeugend eine Barrierecreme im perianalen Bereich erhalten, auch bei intakter Haut. Die sofortige, vorsichtige Entfernung der Ausscheidungen ist hierbei unerlässlich. Wichtig ist, auf Wasser und Seife zu verzichten. Alternativ empfehle ich entsprechende Pflegetücher, die bereits leicht okklusive und pflegende Eigenschaften aufweisen. Sollte sich die Haut weiter röten, wie im Fall einer beginnenden IAD, kann ein Barrierefilm mittels Applikator oder Spray aufgetragen werden. In diesem Fall ist das Spray dem Applikator vorzuziehen, da der Sprühnebel die Haut weniger irritiert als das Auftragen mit dem Applikator. Diese Produkte haften allerdings nur auf intakter Haut. Schreitet die Schädigung weiter voran – die Rede ist dann von einer mäßigen IAD – und die Haut erscheint feucht und nässend, empfehle ich die Anwendung von Cavilon Advanced. Dieser Schutzfilm haftet sehr gut auf der geschädigten Haut, wodurch die Patientin oder der Patient sofortige Schmerzlinderung erfährt. Die atmungsaktive, elastische Schutzschicht ermöglicht es der irritierten Haut darunter, abzuheilen. Das zusätzliche Auftragen anderer therapeutischer Substanzen entfällt. Die Anwendung eines Fäkalkollektors ist an dieser Stelle gut zu überdenken. Die Applikation und die Halteeigenschaften, meist mittels Hydrokolloidplatten, gestalten sich auf der bereits schmerzhaft irritierten Haut problematisch. Zudem übt der Wechsel des Kollektors eine zusätzliche Irritation und Reizung auf die defekte Haut aus. In unseren Häusern legen wir relativ frühzeitig ein Stuhldrainagesystem. Bei diesem Stuhlmanagement werden flüssige Stühle mittels eines weichen Silikonschlauchs, der vorsichtig ins Rektum eingeführt wird, in einen Auffangbeutel abgeleitet. Der Silikonschlauch passt sich den anatomischen Verhältnissen gut an und wird am Kopf des Schlauchs durch einen Retensionsballon blockiert. Somit werden die fäkalen Ausscheidungen effektiv von der Haut zurückgehalten. Ein zusätzlicher Effekt ist die Reduzierung von Gerüchen und potenziell schädlichen Noxen in der Umgebung, was besonders bei infektiös bedingten Diarrhöen von Vorteil ist. Bei den von unserer Klinik angewandten Systemen ist die Verabreichung von Medikamenten und Spülungen durch einen integrierten Medikamenten- und Spülport möglich.
Welche Rolle spielt die Patientenedukation in der Prävention und Behandlung von IAD, und wie können Pflegefachpersonen Patientinnen, Patienten und deren Angehörige dabei unterstützen?
Die Patientin oder der Patient sollte angeleitet werden, seine Feuchtareale möglichst trocken zu halten. Hierbei müssen ihr oder ihm entsprechende Pflegematerialien, inklusive hochwertiger Inkontinenzprodukte, zur Verfügung stehen. Je nach Erkrankung spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Bei nicht infektiösen Diarrhöen kann beispielsweise ein geriebener, ungeschälter Apfel kleine Wunder bewirken. Das in der Apfelschale enthaltene Pektin bindet Wasser und beeinflusst somit die Konsistenz des Stuhls. Die Wirksamkeit des Pektins erhöht sich, wenn der geriebene Apfel etwa 15 Minuten stehen gelassen wird. Durch zusätzliches Schwitzen kann die Situation noch verstärkt werden, weshalb auf Kleidung und Raumtemperatur zu achten ist. Überflüssige Materialien, auf die Patientinnen und Patienten aus "Sicherheitsgründen" zurückgreifen, sind zu entfernen. Wir alle kennen das Phänomen, dass Betroffene zusätzlich zur Inkontinenzhose noch Vorlagen tragen. Auch in den Patientenbetten sind überflüssige Wärmespeicher – etwa gummierte Unterlagen – möglichst zu entfernen. In diesem Fall profitiert die Patientenhaut von der Luft. Weniger ist hierbei mehr – besonders, wenn durch einen Dauerkatheter und eine Stuhldrainage das Risiko einer Verunreinigung stark minimiert wurde. Patientinnen und Patienten sollten ein großes Augenmerk auf die Hautpflege sowie den Hautschutz legen. Hier sind wir Pflegefachpersonen unbedingt gefordert, Patientinnen und Patienten zu diesem Thema zu informieren. Kurze, gut verständliche Informationsbroschüren können dabei unterstützen.
Gibt es aktuelle Forschungsergebnisse oder Entwicklungen im Bereich der IAD, die das Pflegepersonal kennen sollte?
Ich bin überzeugt, dass der neue Expertenstandard "Erhaltung und Förderung der Hautintegrität in der Pflege" (3) noch nicht überall bekannt ist. Er stellt einen leitlinienorientierten pflegerischen Handlungsrahmen dar. Er richtet sich an Pflegefachpersonen, die Menschen mit hautbezogenen Risiken versorgen und behandeln. Wünschenswert wäre auch ein entsprechender ICD-10-Code und somit eine entsprechende Abrechnungsmöglichkeit. Momentan bleibt nur die Möglichkeit, die Erkrankung als "Windeldermatitis", also L22, oder "sonstige näher bezeichnete Dermatitis", also L30.8, zu kategorisieren.
Wie wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Umgang mit IAD, und welche Fachdisziplinen sollten dabei einbezogen werden?
Mit der Erstellung einer entsprechenden Verfahrensanweisung werden sowohl die Pflegequalität gesichert als auch die Zuständigkeitsbereiche festgelegt. Eine enge Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst ist dabei unerlässlich. Dies ist besonders bei der Indikation zur Anwendung einer Stuhldrainage wichtig, da hierbei mögliche Kontraindikationen auszuschließen sind.
Mit welchen Herausforderungen sehen sich Pflegefachpersonen bei der Behandlung von IAD häufig konfrontiert und wie können sie diese überwinden?
Wenn die Ursachen einer IAD bekannt sind, fällt es auch leichter, diese von einem Dekubitus abzugrenzen. Bei der Behandlung von Dekubitus stehen Druckentlastung und die Vermeidung von Scherkräften im Vordergrund. Die übliche feuchte Wundbehandlung würde die Situation einer nicht erkannten IAD hingegen noch verschlechtern. Die vier prägnanten Differenzierungsmerkmale sollten allen Pflegenden bekannt sein.
Welche sind das?
Als erstes ist die Ursache zu nennen. Bei einer IAD handelt es sich immer um eine "Top-Down"-Ursache, im Vergleich dazu haben wir es bei einem Dekubitus mit einer "Button-Up"-Schädigung zu tun. Ursächlich handelt es sich bei einem Dekubitus um eine Schädigung durch Druck, Zeit oder Scherkräfte; bei einer IAD hingegen um das Auftreffen schädlicher Noxen auf die Haut und deren Folgen - Stichworte Ammoniakaktivität, Fäkalenzyme, Mikroorganismen. Als zweites ist die Lokalisation hilfreich. Während sich die Hautschäden bei einem Dekubitus überwiegend über knochigen, prominenten Stellen oder unter medizinischen Geräten befinden, lokalisieren wir die IAD-Schädigungen in der perianalen Umgebung, an den inneren Schenkeln und am Gesäß. Das dritte Differenzierungsmerkmal sind Wundtiefe und -fläche. Sie können weiteren Aufschluss geben: Eine IAD zeigt sich normalerweise oberflächlich und weit ausgebreitet. Die diffusen, unregelmäßigen Wundränder weisen ebenfalls auf eine IAD hin. Bei einem Druckschaden können hingegen auch tiefe Hautschäden entstehen. Das vierte Merkmal ist das Wundbild. Während die Schädigungen bei einem Dekubitus meist klar abgegrenzt sind und manchmal wie ausgestanzt erscheinen, sind die Wundränder bei einer IAD unbestimmt und diffus. Häufig sind sie auch mazeriert. Unterminierungen der Wundränder sowie Tunnelbildungen oder Wundtaschen sind ausschließlich bei Dekubitus-Ulzerationen zu finden.
Wie bewerten Sie die aktuelle Ausbildung und Schulung von Pflegefachpersonen im Hinblick auf das Management von IAD, und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
Das Thema ist in der generalistischen Pflegeausbildung mittlerweile im Abschnitt CE 02 des Rahmenlehrplans curricular verankert. Durch die inzwischen regelmäßigen Schulungen und Fortbildungen hat sich die Situation zwar deutlich verbessert. Es besteht aber noch viel Verbesserungspotenzial. Der neue Expertenstandard "Erhaltung und Förderung der Hautintegrität in der Pflege" stellt für alle Pflegenden eine große Unterstützung dar.
Können Sie Fallbeispiele aus Ihrer Praxis teilen, die erfolgreiche Strategien im Umgang mit IAD veranschaulichen?
Tatsächlich hatten wir vor einigen Jahren in einer Abteilung auffällig viele Dekubitusfälle. Nach intensiver Sichtung sämtlicher gemeldeter Fälle der vergangenen Monate wurde deutlich, dass es sich dabei häufig um Verwechslungen mit einer IAD handelte. Daraufhin erstellte ich eine entsprechende Verfahrensanweisung zur Prophylaxe und Behandlung einer IAD und schulte alle Pflegefachpersonen der Abteilung. Im Folgejahr gingen die Dekubitus-Meldungen fast gegen Null zurück.
Literaturhinweise
(1) Deutsche Haut- und Allergiehilfe, 7. Juli 2016
(2) Deutsche Originalfassung (modifiziert): Steininger, Jukic-Puntigam 2015, Stand: Mai 2015
(3) Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege