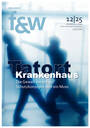Die Kritik an der geplanten Krankenhausreform reißt nicht ab. Wir fassen weitere Reaktionen auf die Analyse zur Auswirkungen der Krankenhausreform auf die Kliniklandschaft zusammen.
Wichtige medizinische Leistungen müssten bei konsequenter Anwendung des Reformkonzepts auf nur noch 36 Krankenhäuser im Rheinland und in Westfalen-Lippe konzentriert werden, so die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW). Der überwiegende Teil der 337 NRW-Krankenhäuser würde ausgeschlossen. Neben Einschnitten in der Krankenhauslandschaft gebe es auch gewaltige Verschiebungen in Behandlungsfeldern: So müssten sich beispielsweise 70 Prozent aller werdenden Eltern eine neue Entbindungsklinik suchen. Zudem würde die Notfallversorgung bei Herzinfarkt oder Schlaganfall stark ausgedünnt.

- Von 358 Krankenhausstandorten in NRW erreichen der Analyse zufolge nur 14 das Level 2 und weitere 22 das Level 3. Neben diesen 36 Kliniken erfüllen zwar 233 Krankenhäuser die Voraussetzung für das neue Level 1n, doch lässt die Vorgabe der Regierungskommission nur 47 Krankenhäuser tatsächlich direkt zu. Alle anderen Häuser liegen zu nah an einem Krankenhaus der höheren Stufe und können deshalb nur als Level 1i mit weitermachen. Dies gilt auch für 63 Krankenhäuser, die direkt in diese Kategorie fallen sollen. Die konkreten Folgen eines solchen Modells illustriert die Auswirkungsanalyse mit vier Beispielen:
- Geburtshilfe: Von 137 Standorten mit einer Geburtshilfe (Stand: 2021) lässt die Beschränkung auf die Level 2 und 3 nur noch 35 Standorte übrig.
- Interventionelle Kardiologie: Akute Herzinfarkte können aktuell in 136 Standorten mit einer interventionellen Kardiologie schnell behandelt werden. Bei Einschränkung auf die Level 2 und 3 bleiben noch 34 Standorte übrig. 70 Prozent der Patientinnen und Patienten müssten auf eines dieser Krankenhäuser ausweichen.
- Neurologische Versorgung: Auch die allgemeine oder komplexe Neurologie soll nur noch in Level 2 oder 3 stattfinden. Damit bleiben 33 statt bisher 74 Standorte übrig. Die Hälfte aller Patienten (52 Prozent) müsste sich eine andere Klinik suchen.
- Urologische Versorgung: Die geplante Verlagerung der allgemeinen und komplexen Urologie in Häuser der Level 2 und 3 lässt nur noch 22 statt bisher 80 Standorte zu. Auch hier müssen 72 Prozent aller stationären Fälle auf die wenigen verbliebenen Standorte ausweichen.
Für KGNW-Präsident Ingo Morell urteilt: „Wer Krankenhausplanung nur nach einem Algorithmus ausrichtet, kann dem realen Bedarf der Menschen in unserem Land nicht gerecht werden.“ Für extrem gefährlich hält Morell die geplante Konzentration bei der interventionellen Kardiologie auf wenige Standorte, wie sie auch für die Schlaganfall-Behandlung geplant ist: „Wenn es um Leben und Tod geht, wenn jede Sekunde zählt, kann in einem Bundesland mit 18 Millionen Einwohnern nicht ein dünnes Netz von wenigen Kliniken die Daseinsvorsorge sicherstellen.“ Aus Sicht der nordrhein-westfälischen Krankenhäuser muss die Krankenhausplanung in der Verantwortung der Länder bleiben.

Von einem Kahlschlag der Krankenhaus-Landschaft durch die Reform könne keine Rede sein, kommentiert Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann. Die Analyse zeige, dass sich "die Patientenströme durch die medizinisch sinnvolle Konzentration von Leistungen ändern werden". Die AOK begrüße, dass sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft in ihrem Papier für effizientere Strukturen ausspricht. Einig sei man sich auch darüber, dass die Definition von bundeseinheitlichen Leistungsgruppen sinnvoll ist und eng mit der geplante Neuregelung der Vorhaltefinanzierung zu koppeln ist.
"Die Vorschläge der Deutschen Krankenhausgesellschaft zur Vorhaltefinanzierung sind aber unnötig kompliziert und würden zusätzliche Bürokratie schaffen", so Reimann weiter. "Insbesondere die Regelung der Vorhaltefinanzierung über die Budgetverhandlungen auf der Ortsebene ist keine gute Idee, denn das birgt unendlich viel Konfliktpotenzial." Zudem werde nicht deutlich, wie die DKG die medizinisch fragwürdige Ausweitung der Fallzahlen aus wirtschaftlichen Gründen eindämmen will. Zudem sei "der Versuch der DKG, die Qualitätssicherung im Krankenhaus auszuhebeln" inakzeptabel.

Den in Niedersachsen eingeschlagenen gemeinsamen Weg werde die Analyse nicht verändern, sagt der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi: "Die Analyse der DKG beruht auf ersten Empfehlungen der Regierungskommission auf Bundesebene. Bereits jetzt laufen intensive Gespräche zwischen Bund und Ländern, um die Ergebnisse zu bewerten." In Niedersachsen habe man mit der Enquetekommission zur medizinischen Versorgung "ein bundesweit vielbeachtetes und sehr modernes Krankenhausgesetz" auf den Weg gebracht. Mit dem neuen Niedersächsischen Krankenhausgesetz und der in naher Zukunft in Kraft tretenden Niedersächsischen Krankenhausverordnung wolle man gemeinsam mit allen Beteiligten die Versorgung in Niedersachsen zukunftsfähig gestalten.

Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft (HKG) sieht erheblichen Nachbesserungsbedarf bei der Krankenhausreform: Ein gutes Viertel der Hamburger Krankenhäuser würde die beiden höchsten Level II und III erreichen, ein weiteres Viertel wäre dem Level In zuzuordnen. Für knapp die Hälfte der Hamburger Krankenhäuser, die teilweise als Fachkliniken hochspezialisierte Medizin erbringen, sei die Perspektive unklar. Die Einstufung in Level benötige Hamburg nicht. "Eine zusätzliche Verknüpfung von Versorgungsstufen/ Level mit Leistungsgruppen lehnen wir ab, da hierdurch keine bessere Qualität, wohl aber Versorgungslücken zu erwarten sind und sinnvolle Strukturen zerstört werden. Die zukünftigen Leistungsgruppen müssen den einzelnen Krankenhäusern unabhängig von Stufen oder Leveln vom Land nach den regionalen Erfordernissen planerisch zugewiesen werden", sagt Joachim Gemmel, 1. Vorsitzender der HKG.
Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft unterstütze das Konzept der DKG, das sich für eine gestufte Versorgung ausspricht, die an dem bereits eingeführten Konzept der Notfallstufen anknüpft und die Forderung nach einer soliden Finanzierung der anstehenden Reform. Verschiedene Vorgaben der Reformempfehlung lösten in Hamburg besondere Probleme aus: So sei die Versorgung in Hamburg bereits hochspezialisiert, 34 Prozent der Krankenhauspatienten und -patientinnen kommen aus dem Umland und von weiter her. Dies müsse in einer Krankenhausreform entsprechend berücksichtigt werden, um die Versorgung nicht zu gefährden. Die Krankenhausreform ziele jedoch in vielen Punkten eher auf die Situation in ländlichen Regionen ab.

Aus Sicht des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (KKVD) macht die Analyse deutlich, dass insbesondere "das Konzept von bundeseinheitlichen Versorgungs-Leveln realitätsfremd ist". Der Verband fordert, sich stattdessen bei der Reform auf die Einführung von Leistungsgruppen zu konzentrieren, die mit Mindeststrukturvorgaben die Qualität sichern.
Der KKVD unterstütze das Anliegen einer Krankenhausreform. Doch nach dem Kommissionskonzept würden laut Auswirkungsanalyse 57 Prozent der derzeitigen Klinikstandorte unter der Vorgabe von mindestens 30 Minuten Fahrzeit zum nächsten Level-2- oder Level-3-Haus zu regionalen Gesundheitszentren herabgestuft. Sie dürften als Level 1i-Einrichtungen faktisch keine Krankenhausleistungen mehr erbringen. Bei den freigemeinnützigen Häusern wären dies sogar knapp 70 Prozent der Standorte.
Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des KKVD, sagt: „Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Dazu gehört eine an Leistungsgruppen orientierte Krankenhausplanung, die vor Ort durch die Länder gemacht wird. Mit einheitlichen Mindeststrukturvorgaben sichern solche Leistungsgruppen die Qualität. Sie jedoch mit bundeseinheitlichen Versorgungs-Leveln zu verknüpfen ist ein Irrweg, den der Minister schnell verlassen sollte." Zudem dürfe bei der Reform auch der Erhalt der Trägervielfalt nicht aus dem Blick geraten.