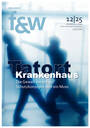In den Eckpunkten findet sich zur Finanzierung lediglich ein Prüfauftrag. Dabei stehen die Kliniken finanziell mit dem Rücken an der Wand. Diese Krankenhausreform nimmt Insolvenzen bewusst in Kauf.
Seit der ersten Ankündigung einer Krankenhausreform als „Revolution“ gab es wichtige Veränderungen. Verfassungsrechtlich klargestellt wurde die Länderverantwortung für die Krankenhausplanung. Die Level spielen kaum noch eine Rolle. Planerisch trägt die Reform nun die Handschrift aus Nordrhein-Westfalen mit Leistungsgruppen, die die Strukturqualität bestimmen. Gut ist, dass die Länderplanung vereinheitlicht und das Finanzierungssystem auf Bundesebene besser mit der Planungssystematik abgestimmt werden kann. Doch erst das weitere Gesetzgebungsverfahren wird zeigen, ob und wie die Leistungsgruppenplanung mit einer Vorhaltefinanzierung wirklich praktisch zusammenpassen. Der Transformationsprozess mit Tauschaktionen von Leistungsgruppen und Umbaumaßnahmen wird Jahre dauern.
Finanzkrise
Der Finanzdruck in den Krankenhäusern ist kaum noch beherrschbar. Im Regelwerk mit Orientierungswert, Veränderungsrate und Veränderungswert können Krankenhäuser nach aktueller Systematik bestenfalls nach zwei Jahren Zeitverzug einen Inflationsausgleich erhalten; und auch nur dann, wenn die GKV-Grundlöhne sich entsprechend entwickeln. Ende 2022 hat die Bundesregierung den Ganzjahresausgleich auslaufen lassen. Zeitgleich wurde die Regelungsmöglichkeit bundesgesetzlich gestrichen, beim Landesbasisfallwert (LBFW) den Rückgang an Behandlungsfällen bezüglich höherer Fixkostenanteile je Fall erhöhend berücksichtigen zu können, wodurch allein der LBFW strukturell um gut fünf Prozent unterfinanziert bleibt.
In den Eckpunkten findet sich zur Finanzierung lediglich ein Prüfauftrag. Dabei stehen die Kliniken finanziell mit dem Rücken an der Wand. Die aktuellen Hilfsfondszahlungen laufen aus, während die Inflation weiter hoch bleibt. Gleichzeitig wird im Sanierungs- und Insolvenzrecht die Nachweispflicht einer positiven Fortführungsprognose wieder von vier auf zwölf Monate verlängert. Dadurch wird die Zahl von Insolvenzen 2024 massiv steigen, woran auch reine Liquiditätshilfen wie eine schnellere Auszahlung des Pflegebudgets nichts ändern würden. Ein verlässlicher Krankenhausbetrieb wird unter diesen Rahmenbedingungen 2024 vielfach nicht mehr möglich sein.
Transparenz und Qualität
Der Bundesgesundheitsminister möchte die Qualitätstransparenz erhöhen, was aus seiner Sicht „dringend geboten“ sei. Dagegen ist nichts einzuwenden. Doch die aktuelle Streichung der BMG-Fördermittel „aus Haushaltsgründen“ für das Deutsche Krankenhausverzeichnis mit Transparenz der Strukturqualität passt nicht in dieses Bild. Es bleibt abzuwarten, mit welchem zusätzlichen Bürokratieaufwand noch weitere Daten in den Kliniken erhoben werden sollen. Auffällig ist, dass in den Eckpunkten die Prozess- und Ergebnisqualität (PROMs, PREMs) kaum betrachtet werden – schon gar nicht sektorenübergreifend. Ebenso werden Wartezeiten als eine zentrale Herausforderung für die Qualität völlig ausgeblendet.
Marketing des BMG
Die Kommunikation von Minister Lauterbach ist clever. Er betont seine Ziele wie Entökonomisierung, Entbürokratisierung und beste Qualität. Gleichzeitig hebt er hervor, dass es „marode Krankenhäuser“ gäbe. Der Bundesminister spricht offen davon, dass „viele Insolvenzen nicht mehr zu vermeiden wären“ und dafür leider „die Krankenhausreform zu spät komme“.
Zur Erinnerung: Der nicht verlängerte Ganzjahresausgleich, der fehlende Inflationsausgleich und die bewusste gesetzliche Streichung der Berücksichtigung sinkender Fallzahlen beim LBFW fallen in die Amtszeit dieser Bundesregierung. Deshalb hat Lauterbach die selbst angekündigten Insolvenzen zu verantworten. Es wäre nicht zu viel verlangt gewesen, bis zur Wirksamkeit einer Krankenhausreform eine Budgetabsicherung (zum Beispiel über den Ganzjahresausgleich) fortzuführen und die Erlöse den nachgewiesenen Kostensteigerungen anzupassen. Bisher kann der Bundesgesundheitsminister noch medial punkten. Nach der Coronapandemie spielt die Versorgungssicherheit in den Medien keine große Rolle mehr. Ob dies so bleibt, ist mit zunehmenden Insolvenzen unwahrscheinlich.
Disruptive 5-Punkte-Formel
Es gibt einen breiten Konsens für eine Krankenhausreform, um auf die demografischen Herausforderungen zu reagieren. Zum Fachkräftemangel fehlen in den Eckpunkten aber konkrete Lösungsansätze. Vielmehr lässt sich ein einfaches Denkmodell in dieser Krankenhausreform mit bewusster Inkaufnahme von Insolvenzen erkennen:
- Bessere Qualität durch weniger stationäre Behandlungen
- Weniger stationäre Behandlungen durch weniger Krankenhausstandorte
- Weniger Krankenhausstandorte durch viele Insolvenzen
- Viele Insolvenzen verteilen die Finanzmittel und Fachkräfte schnell um.
- Überlebende Kliniken bekommen dann ausreichende Mittel für bessere Qualität.
OECD-Vergleiche zu Bettendichte und Operationszahlen liefern für diese disruptive Formel vermeintlich wissenschaftliche Belege, dass es trotz Insolvenzen nicht zu einer Unterversorgung kommen werde. Mit Hinweis auf „Level 1i“ kann die Bundespolitik davon sprechen, dass kein Krankenhausstandort geschlossen werden muss. Zumal die konkreten Entscheidungen und Diskussionen auf Landes- und Kommunalebene stattfinden werden.
Denkfehler der Eckpunkte
Wir haben in der Coronapandemie erlebt, dass die Versorgung und deren Qualität von den Menschen bestimmt werden. Eine bessere Qualität wird nicht über Insolvenzen erreichbar sein, weil dabei viele Fachkräfte aus dem Beruf aussteigen. Gute Qualität ist nur mit eingespielten Teams und einem stabilen, strukturellen Fundament möglich. Dies wird übrigens auch eine große Herausforderung bei den Tauschaktionen der Leistungsgruppen werden.
Eine Reduzierung stationärer Behandlungen wird nicht allein über die Maßnahmen in den Eckpunkten möglich sein, auch wenn die Vorhaltefinanzierung richtige Signale setzt. Ein Vergleich der Bundesländer zeigt, dass die Zahl der Krankenhausstandorte nicht direkt die Zahl der Behandlungsfälle bestimmt. Wichtiger wäre eine gezielte Förderung der ambulanten Behandlung am Krankenhaus, eine bessere Patientensteuerung und gestufte Notfallversorgung sowie bessere Nachsorgeangebote zur Vermeidung von Drehtüreffekten. Ansonsten drohen längere Fahrwege und Wartezeiten.
Auch „überlebende“ Krankenhäuser werden weiterhin das Problem nicht ausreichend finanzierter Betriebskosten haben, solange ihnen der Inflationsausgleich fehlt. Sowohl eine Entökonomisierung als auch eine bessere Versorgungsqualität wären dann unmöglich.
Prognose
Ohne einen Ausgleich der Finanzierungslücke wird ein Scherbenhaufen unvermeidlich. Es wären erhebliche Mittel erforderlich, um das bisherige Leistungsniveau der Kliniken wieder aufbauen zu können. So eine Krankenhausreform wird nicht erfolgreich sein.
Wenn dagegen eine verlässliche Betriebskostenfinanzierung sichergestellt ist und ausreichend Mittel für die Transformation von Bund und Ländern bereitstehen, kann ein Reformprozess mit besserer Versorgungskoordination und stärkerer Spezialisierung über eine Leistungsgruppenplanung gelingen. In der Planungshoheit der Länder wird die räumliche und zeitliche Verfügbarkeit der Versorgung eine wichtigere Rolle einnehmen, um Wartezeiten zu verhindern.