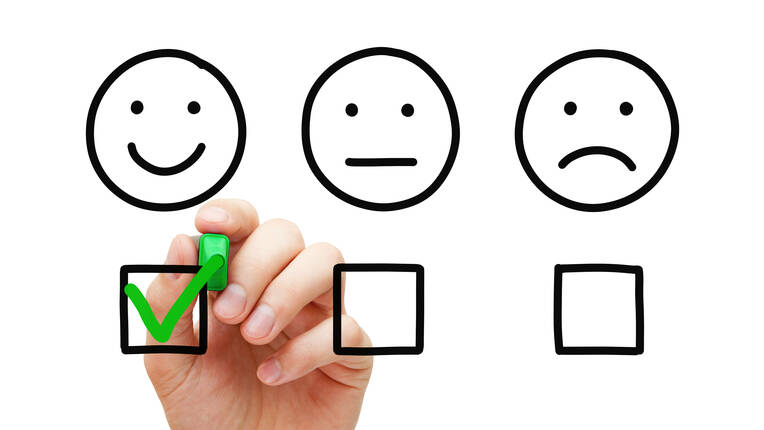Klinikleitungen können das System der Zusammenarbeit in ihrer Klinik auch selbst zukunftsweisend verändern und das Personal entlasten, weiß unsere Autorin Vera Starker und stellt drei Beispiele vor.
Unzweifelhaft sind die Herausforderungen im Gesundheitswesen trotz erster Reformen auch weiterhin groß. Was können wir tun? Schauen wir uns drei Beispiele an.
Diverse Studien belegen, dass multiprofessionelle Teamarbeit zu besseren Patienten-Outcomes führt, den Stress im Team senkt und – das ist auch ohne Evidenzbasierung nachvollziehbar – schlichtweg mehr Spaß macht sowie die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Klinikpersonals bewahrt. Gegen eine solche Teamarbeit sprechen weder rechtliche Hinderungsgründe noch arbeitsbezogene. Die Widerstände finden sich in den Köpfen, in der Haltung einzelner Beteiligter und im berufsidentifikatorischen Standesdünkel, hinter den dann im Zweifel auch ein besseres Patienten-Outcome zurücktreten muss.
Führung und Übertragung von Verantwortung
Wenn Führung Machen bedeutet, dann haben Prof. Dr. Walcher von der DIVI und sein Team eindrucksvoll „gemacht“. Das (Arbeits-)Motto des letzten Kongresses lautete: Interdisziplinarität stärken – Multiprofessionalität leben! Dieses Motto wurde von sehr vielen Teilnehmenden als ein echter Paradigmenwechsel erlebt, der eine klare Richtung vorgibt und vor Ort diskutiert werden konnte. Beleuchtet wurde unter anderem, wie es einigen Stationen schon länger gelingt, ohne berufsbezogene Hierarchien in multiprofessionellen Expertenteams zu arbeiten – wo jeder gemäß seiner oder ihrer Expertise zum Behandlungs- und Heilungserfolg beiträgt –, während auf anderen Stationen noch die klassische Trennung der Berufe herrscht und in Silos gearbeitet wird. Persönlichkeit und Machen: Auch das macht den Unterschied.
Die meisten deutschen Kliniken arbeiten (noch) mit klassischen hierarchischen Strukturen. Das hier wirksame tayloristische Prinzip „Oben wird gedacht, unten wird gemacht“ entstammt jedoch dem Industriezeitalter – ist also überholt – und führt auch in Kliniken dazu, dass Menschen nur als Vorgabenempfänger agieren. Mittlerweile wissen wir sowohl aus Studien zum psychologischen Empowerment als auch aus der Forschung rund um die psychische Gefährdungsbeurteilung, dass Partizipation, Entscheidungsverantwortung und Handlungsautonomie nicht nur die Motivation und die Bindung, sondern auch die (psychische) Gesundheit stärken. Insofern verwundert es nicht, dass mittlerweile in vielen Befragungen hierarchische Strukturen und eine autoritäre Führungskultur von Berufsanfängern als Gründe für eine Entscheidung gegen eine Karriere im Krankenhaus angegeben werden. Und die kollektive Abwertung dieser jungen Generation als nicht leistungsfähig und -bereit, wie sie in vielen Kliniken betrieben wird, lenkt nur davon ab, dass die seit Jahren bekannten Probleme – die auf dem Rücken der altruistischen Motivation ganzer Ärzte- und Pflegegenerationen ausgetragen wurden – immer noch nicht gelöst sind.
Politische Vorgaben braucht es für diese hier notwendigen Veränderungen jedoch nicht. Wenn Führung Machen bedeutet, hat Hubertus Schmitz-Winnenthal, Chefarzt der allgemeinchirurgischen Station im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, es eindrucksvoll anders gemacht. Er hat den Prozess für die erste selbstorganisierte Station ins Rollen gebracht. „Meine Station“ ist ein einzigartiges Pilotprojekt: eine Station in einem deutschen Krankenhaus, die nach dem Modell der Selbstorganisation funktioniert. Hier wird eine chirurgische Station neu aufgebaut und insbesondere die Zusammenarbeit als interdisziplinäres Stationsteam völlig neu gedacht. Die Arbeitsbedingungen werden überwiegend selbst gestaltet, und die Station ist nicht in die klassischen Hierarchien eingebettet. Die Auflösung des Positionsdenkens hin zu einem rollenbasierten, auf medizinische Wertschöpfung ausgerichteten Teamhandeln ist mit Sicherheit der aktuell umfassendste Veränderungsprozess in Richtung eines neuen Arbeitsverständnisses in Kliniken. Die eigenen Vorbehalte zu reflektieren und konsequent mit multiprofessioneller Teamarbeit zu starten oder diese zu stärken, wäre also schon ein Anfang!
Fokussierung und Entbürokratisierung
Die Arbeit in Kliniken ist naturgemäß mit vielen Arbeitsunterbrechungen verbunden. Allerdings konnte in mehreren Studien gezeigt werden, dass ein Großteil der Unterbrechungen auf Prozessfehler und nicht auf – wie man vermuten würde – die Patienten und die Notfälle zurückzuführen ist. Notorisches Multitasking und Arbeitsunterbrechungen stressen jedoch vor allem die von unserer Fokussierungsfähigkeit abhängigen kognitiven Funktionen. Darunter fallen unter anderem
- das Erkennen von Problemen,
- die Einleitung von passenden Maßnahmen,
- die Fähigkeit, zu priorisieren,
- die Empathie und
- die eigene Impulskontrolle.
Insbesondere die Kompetenz, zu priorisieren, ist im klinischen Alltag, der von Informationsüberflutung sowie Aufgaben- und Anfragenvielfalt geprägt ist, eine der wichtigsten Eigenschaften überhaupt. Es konnte ermittelt werden, dass Medikationsfehler sowohl des Pflege- als auch des ärztlichen Personals als Folge von Unterbrechungen auftreten und die Unterbrechungsfrequenz positiv mit dem Schweregrad der Fehler korreliert. Auch in der Chirurgie und der Anästhesie wurde eine erhöhte Fehlerrate als Auswirkung von Unterbrechungen ermittelt. Überdies nehmen Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte Unterbrechungen als bedeutsamen Einflussfaktor bezüglich der eigenen Arbeitsbelastung und Arbeitsbewältigung wahr.
Wenn Führung Machen bedeutet, dann macht David-Ruben Thies, CEO der Waldkliniken Eisenberg, es ebenfalls entschieden anders. Ärztinnen und Ärzte müssen dort nicht mehr codieren, die Bürokratie wurde durch eine digitale Patientenakte reduziert, und Arbeitsprozesse wurden in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitspersonal angepasst, fokussiert und defragmentiert. Zudem ermöglicht die Trennung von Aufnahme und postoperativen Stationen eine fokussiertere Betreuung. Derzeit setzt man dort den Partizipationsprozess in einem New-Work-Prozess fort. Die Verringerung von Arbeitsunterbrechungen und Multitasking reduziert in der Folge das Stresserleben und die emotionale Erschöpfung der Beteiligten, was wiederum systematisch die organisationale und individuelle Resilienz stärkt.
Klinikleitungen haben die Möglichkeit, das System der Zusammenarbeit innerhalb ihrer Kliniken zukunftsweisend zu verändern, um die oben beschriebenen positiven Effekte zu erreichen. Der Verweis auf das DRG-System oder einen fehlenden politischen Willen entlässt sie nicht aus der Pflicht, diese Veränderungen zu initiieren. Und da es bereits Kliniken gibt, die das tun, können wir sagen: nur Mut – es geht!