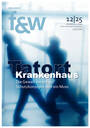Im Vergleich mit anderen Ländern liegt Deutschland in der Pflege mit Blick auf Themen wie die Akademisierung, die Verantwortung bei der Patientenversorgung oder das Thema Ausbildung zurück. Das hat eine Studie im Auftrag der Stiftung Münch ergeben, bei der die Situation der Pflege in Großbritannien, den Niederlanden, Schweden und Kanada mit Deutschland verglichen wurde.
Die Studienautoren unter der Leitung von Michael Ewers, dem Direktor des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Charité, untersuchte unter anderem, wie viel Verantwortung die Pflegenden in den einzelnen Ländern in der Patientenversorgung übernehmen dürfen. In Deutschland werde meist am Prinzip der ärztlichen Delegation festgehalten. Dabei handeln die Pflegenden auf Anweisung des Arztes. In den anderen Ländern finde hingegen eine "partnerschaftlich angelegte, teamorientierte und gesetzlich legitimierte Aufgabenneuverteilung" statt. Dadurch entstünden mehr Entwicklungsmöglichkeiten für Pflegende als hierzulande. "Das macht innovative Versorgungsformen möglich, von denen letztlich Patienten und Pflegende gleichermaßen profitieren", heißt es in einer Mitteilung zu der Studie. Deshalb fordern die Autoren, die Pflege durch neue Formen der Aufgaben- und Verantwortungsteilung in Deutschland zu stärken.
Dass Pflegekräfte in anderen Ländern mehr Verantwortung übernehmen, liege zudem daran, dass dort mehr Pflegekräfte studiert haben. In Deutschland liege der Anteil der Pflege-Absolventen eines Jahrgangs mit einem Pflege-Studium lediglich bei ein bis zwei Prozent. In den Niederlanden sind es der Studie zufolge etwa 45 Prozent, in Schweden und Großbritannien 100 Prozent.
Als Unterschied hoben die Studienautoren zudem hervor, dass in Großbritannien, Schweden, den Niederlanden und Kanada die Aus- und Weiterbildung von Pflegenden in den regulären Bildungsstrukturen verortet sei. In Deutschland nehme die Pflegebildung hingegen eine berufs- und bildungsrechtliche Sonderstellung ein: Sie unterliegt meist nicht - wie für allgemein- und berufsbildende Schulen üblich - dem Schulrecht der Länder. Die Pflegeausbildung sei deshalb mit Blick auf die die Finanzierung, Ausstattung und die Qualifikation des Lehrpersonals benachteiligt, urteilen die Autoren. Zudem unterliege sie nicht der externen Qualitätssicherung und -entwicklung, wie sie für andere Berufsschulen geregelt ist. Auch hier sehen die Autoren Handlungsbedarf.
Mit Blick auf die Änderungen in Deutschland durch das Pflegeberufegesetz, erklärte Studienleiter Michael Ewers, dies könne nur "ein erster Schritt einer umfassenden Reform der Qualifizierungen und Berufsausübung in der Pflege sein.“ Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Münch, Stephan Holzinger, hält der Politik vor, sie verhalte sich widersprüchlich. Einerseits wolle sie die Pflege aufwerten. Andererseits setze sie unter anderen durch das Herauslösen der Pflege aus dem DRG-Vergütungssystem, den wirtschaftlichen Anreiz, dass Pflegefachkräfte demnächst wieder zur Essensausgabe und zur Zimmerreinigung mit eingesetzt würden.