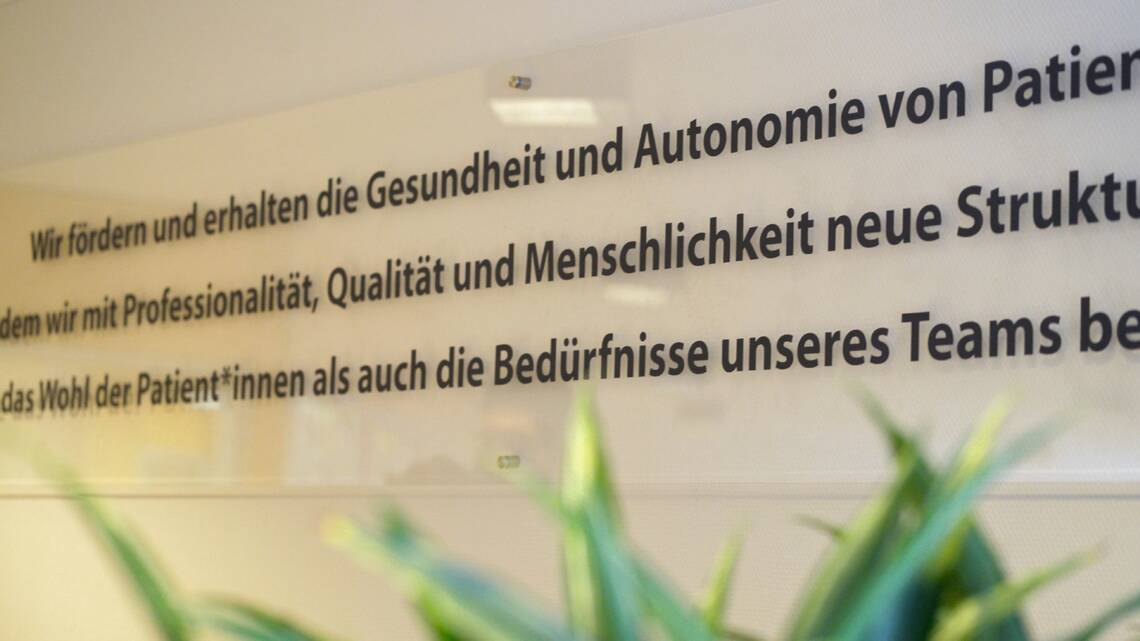Chefarzt Professor Dr. Hubertus Schmitz-Winnenthal hat eine Station des Klinikums Aschaffenburg nach New-Work-Prinzipien radikal umgebaut. Für seinen Mut und sein Engagement erhält er den Vordenker-Award 2024. Im Interview zieht er nach gut einem Jahr eine Zwischenbilanz und erklärt, warum „Meine Station“ auch auf andere Kliniken übertragbar ist.
Herr Professor Schmitz-Winnenthal, Sie haben die selbstorganisierte Station am Klinikum Aschaffenburg ins Leben gerufen. Räumen wir am besten das größte Vorurteil aus: Bei Ihnen macht nicht jeder, was er will – oder etwa doch?
Natürlich nicht. Ob Sie es glauben oder nicht: Was wir tun, ist hochgradig spießig! Ein Beispiel: Wir hatten gestern ein Meeting mit 17 Tagesordnungspunkten. Die haben wir in 45 Minuten sauber und stringent abgearbeitet. Das ging nur, weil wir uns klare Regeln und Strukturen gegeben haben.
Warum haben Sie dieses Projekt gestartet?
Die Medizin ist ein unglaublich wertvoller Beruf. Wir stoßen aber mehr und mehr an Grenzen. Wenn man krank ist, dann kann der Arzt nicht gut genug sein, dann kann die Pflege nicht stramm genug am Bett stehen, dann muss alles top funktionieren. Es ist absurd, dass die Menschen, die diese Leistung erbringen, ihren Job nicht als ebenso wertvoll wahrnehmen. Mich begeistert der ursprüngliche Gedanke von New Work: Die Arbeit ist für dich da! Sie soll dich ausbilden, weiterbringen und substanzieller Bestandteil deines guten Leben sein. Der Wert der Arbeit ist für mich immens, gerade in der Medizin. Und hier müssen wir ansetzen: Wenn der Job gut ist, kommen Sie gerne zur Arbeit, dann dient mir die Arbeit, nicht ich ihr. Wenn der Job schlecht ist, hilft beispielsweise auch keine Vier-Tage-Woche – dann müssen sie sich halt vier Tage zu einem schlechten Job schleppen.
Was kennzeichnet die Arbeit auf einer selbstorganisierten Station?
Vorweg: Selbstorganisation ist nicht das Ziel dieser Station, sondern eine Methode, ein Werkzeug! Wir wenden sie an, um die Bedürfnisse der Menschen in die Arbeitsabläufe zu integrieren. Eine Pflegekraft, die in einem selbstorganisierten Setting unterwegs ist, hat die Möglichkeiten, ihre Arbeit und Abläufe und damit einen wichtigen Teil ihres Lebens mitzugestalten und zu verändern.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ein Beispiel sind die Arbeitszeiten. Wenn jemand nicht um 6.30 Uhr anfangen kann, dann kann er oder sie bei uns in einem bestimmten, gut strukturierten Prozess ein passendes Arbeitszeitenmodell entwickeln. Ein weiteres Beispiel: Wenn eine Pflegekraft erkennt, dass ein Patient einen anderen Tagesablauf braucht, dann kann man das ebenfalls über unseren standardisierten Prozess anstoßen und die Veränderung sofort implementieren. Deshalb ist diese Station auch nie fertig. Wir sind ständig dabei, Dinge zu verändern.
Wie sind Sie gestartet?
Wir haben im Februar 2023 begonnen. Diese Station stand nach der Coronapandemie leer. Wir haben ein komplett neues Team zusammengestellt – etwas, was ich im Regelfall niemandem empfehlen würde! Wir haben keine Auswahlgespräch geführt, sondern Workshops organisiert, wo wir unsere Methoden vorgestellt haben und herausfinden wollten, wer Lust hat, so zu arbeiten. So hat sich das Team selbst gefunden. Nach einem Jahr sind wir nun in einer Art Betaphase. Einiges funktioniert, anderes nicht. Wir haben aber vieles erreicht: Es macht viel mehr Spaß als früher – und die Patienten werden besser behandelt.
Wie viele Mitarbeiter kamen aus dem eigenen Haus, wie viele von außen?
Wir haben uns für einen Anteil von 70 Prozent Externer entschieden, auch um uns im eigenen Haus keine Konkurrenz zu machen. Das war eine schwierige Gratwanderung, weil wir auf der einen Seite das Projekt kleinreden mussten. Auf der anderen Seite haben sich einige Menschen dadurch nicht richtig mitgenommen gefühlt.
Projekt „Meine Station“
„Meine Station“ ist ein Pilotprojekt am Klinikum Aschaffenburg, das 2023 gestartet ist. Im Sinne einer selbstorganisierten Station gestaltet das Stationsteam die Arbeitsbedingungen überwiegend selbst, trifft gemeinsame Entscheidungen und kann so die eigenen Bedürfnisse bestmöglich in den Arbeitsalltag integrieren. Für das Stationsprojekt hat sich ein komplett neues Team aus hausinternen und externen Bewerber:innen zusammengefunden. Mehr Informationen:
Lässt sich der Erfolg von „Meine Station“ in Zahlen messen?
Diese Station trägt sich und schreibt schwarze Zahlen. Wir sind mit 20 Betten eine recht kleine Station und haben innerhalb von einem Jahr über 900 Patienten behandelt – darunter viele hochkomplexe Patienten und Notfälle. Unser Case Mix Index (CMI) liegt bei ca. 1,8, vergleichbare Kliniken haben einen CMI von 1,4. Trotzdem ist unsere Liegezeit kürzer. 70 Prozent der Patienten könne 1,8 Tage früher nach Hause gehen. Das ist ca. 20 Prozent schneller als der Bundesdurchschnitt. Aber, das möchte ich ausdrücklich betonen: Das ist nur eine Nebenwirkung! Wenn Sie es dem Team ermöglichen, Patienten schnell gesund zu machen, dann verkürzt sich die Liegezeit. Wenn Sie ein Team hingegen quälen, schneller zu entlassen, dass ernten Sie Frust, Widerstand und schlechte Stimmung.
Was machen Sie diesbezüglich anders?
Wir wollen unseren Patienten eine naturwissenschaftlich fundierte Spitzenmedizin emphatisch-menschlich zugänglich machen. Die Medical Science ist aber nur eine Säule. Die Medical Arts, die Heilkunst, ist in der Medizin verkümmert. Diese stärken wir. Es gibt wissenschaftliche Belege, wonach Patienten, die mit Mitgefühl und Empathie behandelt werden, besser versorgt sind. Die Rückmeldungen der Patienten geben uns Recht. 40 Prozent haben an der Patientenbefragung teilgenommen und gespiegelt, dass wir bei den Themen trumpfen, die uns am Herzen liegen: gute Versorgung, empathischer Umgang und Dialog auf Augenhöhe.
Wie ist es um die Personalfluktuation bestellt?
Die ist sehr niedrig. Wir sind mit 20 Personen gestartet und liegen jetzt bei 38. Wir haben auch qualitativ gut akquiriert, zum Beispiel eine onkologische Fachpflegekraft und drei ehemalige Leitungskräfte. Bei uns arbeiten Pflegekräfte und Ärzte aller Altersgruppen, das Projekt ist also mitnichten nur für junge Hipster. Wir beschäftigen auch Menschen, die nur noch wenige Jahre zu arbeiten haben, ihre Erfahrung einbringen und begeistert sind, etwas zu verändern.
Was sind die größten Fallstricke für ein solches Projekt?
Die Spannungen zu managen ist definitiv die größte Herausforderung. Sie sind einerseits Treibstoff der Veränderung. Dazu müssen sie in den „Tank“. Andererseits können sie einem gehörig um die Ohren fliegen. Sie müssen lernen, Spannungen transparent zu machen und Settings zu schaffen, wo Mitarbeiter diese Spannungen iterativ abbauen können. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.

"Wir haben Kolleginnen, die genau deswegen wieder in den Beruf "zurückgekommen sind. Das Arbeiten macht einfach wieder Spaß."
Sabrina Heilmann, Gesundheits- und Krankenpflegerin auf „Meine Station“
Wie unterscheidet sich der Behandlungsprozess auf dieser Station?
Der Behandlungspfad hat sich dramatisch verändert. Das ist das Ergebnis unserer Transformation. Auch hier sei gesagt: Es ist nicht das Ziel von Selbstorganisation in einem Krankenhaus, den Patientenpfad zu verändern. Das macht das Team schon von sich aus. Die Elektivpatienten kommen zwei Wochen vor der Operation zur Aufklärung. Die Patienten werden aufgeklärt, dass sie auf einer selbstorganisierten Station behandelt werden. Wir schulen sie und zeigen ihnen, wie sie sich selbst helfen können, wenn sie beispielsweise Schmerzen haben, oder wie sie nach der Bauch-OP wieder aus dem Bett aufstehen können. Eine klassische Visite mit abgehetzten Dienstärzten gibt es bei uns nicht mehr. Die Patienten kommen zu einem bestimmten Termin ins Behandlungszimmer. Das hat den großen Vorteil, dass sie auch ihre Angehörigen mitbringen können. Dort bieten wir ihnen ein gutes Gespräch mit einem vorbereiteten Arzt. Das dauert etwas länger, dafür ist aber auch alles erledigt.
Welche neuen Rollen gibt es auf der Station – und welche alten Jobs nicht mehr?
Von den alten Positionen gibt es praktisch keine mehr, ein Beispiel ist die Stationsleitung. Wir haben stattdessen überall neue Rollen und unterscheiden zwischen „Roll“ und „Soul“. Nicht mehr die Person soll etwas verkörpern, sondern die Rolle, über die sich Verantwortlichkeiten definieren. Nehmen Sie das Beispiel Hygiene: Das Team vertraut diese Rolle einer Person an. Diese tritt dann in dieser Rolle auf und nicht mehr als Individuum. Wenn das nicht funktioniert, wechselt die Rolle. Weitere Beispiele für neue Rollen sind Patientenpaten, welche die Patienten während ihres Aufenthalts begleiten, oder das Recruiting. Die Sichtung von Bewerbungen und Bewerbungsgespräche begleitet zum Beispiel eine Person.
Rollenbasiertes Arbeiten
Auf „Meine Station“ gibt es keine klassische Stationsleitung mehr. Stattdessen übernehmen verschiedene Mitglieder des Teams diese administrativen Aufgaben. Neben festen Rollen gibt es flexible, vor allem in der Patienten- versorgung. Diese werden vor jeder Schicht verteilt. So gibt es beispiels- weise die Rollen Blutabnehmer, Infusionsrichter oder Medikamentenvorbereiter. Ein Teammitglied mit der Rolle Teamkoordinator stellt sicher, dass in der jeweiligen Schicht alle Rollen gefunden wurden.
Wie hat sich Ihre Arbeit als Chefarzt verändert?
Ich als Chefarzt trage die Verantwortung für das alles, auch für die Patienten, daran hat sich nichts geändert. Ein großer Unterschied zu früher ist, dass ich heute viel öfter Dinge ermöglichen soll. Ich fungiere weniger als Ideengeber. Natürlich denke ich viel mit und bin Teil der Prozesse und Veränderung im Team. Aber ich muss viel mehr zuhören, aufnehmen, verstehen – und dann überlegen, wie wir das umsetzen können.
Ist dieses Setting auch auf andere Stationen und Krankenhäuser übertragbar?
Unser konkretes Projekt hängt sehr stark von den Gegebenheiten hier vor Ort ab – und ehrlich gesagt auch ein Stück weit von mir. Die Methoden an sich lassen sich ohne Weiteres auf andere Kliniken übertragen. In einer internistischen oder neurologischen Klinik werden Prozesse und Resultate aber ganz andere sein. Grundsätzlich gilt: Wenn man es Menschen ermöglicht, werden sie sich anders verhalten. Ein gutes Beispiel ist das Thema Wirtschaftlichkeit. Die Mitarbeiter haben von sich aus begonnen nachzufragen, ob sich unser Projekt rechnet. Das Thema Untergrenzen und Entlassungen vor 12.00 Uhr führt in der Regel zu viel Unmut. Bei uns ist genau das Gegenteil eingetreten. Die Mitarbeiter haben selbst überlegt, wie sie den Patienten vor 12.00 Uhr entlassen können – aber eben nicht rausschmeißen müssen. Nun nutzen wir unseren Aufnahmebereich am Nachmittag als Entlassbereich. Das hat das Team alleine von sich aus entwickelt, ohne dass ich etwas angestoßen hätte.
Welche Rolle spielte der Betriebsrat bei diesem Konzept?
Der Betriebsrat hat uns gut begleitet, wir haben eine eigene Betriebsvereinbarung verhandelt. Das größere Problem sind die Tarifverträge. Die passen nicht zu solchen Konzepten und funktionieren einzig und allein in einer Pyramide des Unterstellungssystems – zumindest bei der Pflege. Wenn hier jemand Verantwortung übernimmt, kann das nicht besser entlohnt werden. Aus meiner Sicht muss mit Verdi ein New-Work-Tarifvertrag verhandelt werden.
„Meine Station“ hat sich zu einem Leuchtturmprojekt der New-Work-Bewegung entwickelt. Sind Sie zum Erfolg verdammt?
Wir haben mit diesem Projekt schon jetzt sehr viel gelernt und eine gute Basis, um weiterzumachen. Es funktioniert gut. Natürlich gibt es einen gewissen Druck, dass „Meine Station“ funktioniert. Denn wo sind die Alternativen? Fakt ist: Die Menschen verlassen in Scharen das Gesundheitssystem, und ich kann es auch nachvollziehen. Wir müssen Wege finden, die Medizin für uns zu nutzen, um uns zu entwickeln und uns zu verwirklichen.

Prof. Dr. Friedrich Hubertus Schmitz-Winnenthal ist seit 2014 Chefarzt der Chirurgischen Klinik 1 am Klinikum Aschaffenburg. Nach seinem Medizinstudium in Frankfurt am Main und einem Forschungsaufenthalt an der Harvard University in Boston absolvierte er die Ausbildung zum Allgemein- und Viszeralchirurgen bei Prof. Dr. Büchler an der Universität Heidelberg. Er hat einen MBA in Healthcare Management an der DHBW Mannheim abgeschlossen und wurde 2018 außerplanmäßiger Professor der Universität Heidelberg für das Fach Chirurgie, das er bis heute dort unterrichtet.
Laudatio der Jury
Der Personalmangel ist eine der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen. Viele Kliniken suchen händeringend nach Fachkräften – oft vergeblich. Das Problem droht sich in den kommenden Jahren weiter zu verschärfen, auch weil das Krankenhaus für immer mehr Beschäftigte kein attraktiver Arbeitsplatz mehr ist.
Die Jury verleiht den Vordenker-Award 2024 an Prof. Dr. Friedrich Hubertus Schmitz-Winnenthal. Der Chefarzt der Chirurgischen Klinik I am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau ist davon überzeugt, dass Kliniken mit ihren bestehenden Strukturen die Probleme der Zukunft nicht lösen können. Er hat das Projekt „Meine Station“ initiiert, die erste selbstorganisierte Station in einem deutschen Krankenhaus. Dort denken er und sein Team die Arbeitswelt radikal neu. Ziel ist es, die Begeisterung für den eigenen Beruf wieder zu entfachen und ein nachhaltiges Umfeld für alle medizinischen Berufe zu schaffen. Die Mitarbeiter gestalten die Strukturen und Prozesse ihrer Station selbst. Sie haben die strikte Trennung von ärztlichem Dienst und Pflege abgeschafft, neue Rollenkonzepte entwickelt und wollen alte Verhaltensweisen und Muster ablegen. Auch die Patienten sollen in den Genesungsprozess besser einbezogen werden als zuvor.
„Meine Station“ fordert von allen Beteiligten Kraft und Ausdauer – und ist ein Experiment mit offenem Ausgang. Die Jury ist beeindruckt von dem Mut und dem Engagement, mit dem Friedrich Hubertus Schmitz-Winnenthal als Chefarzt Hierarchien schleift, die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert und Verantwortung in die Hände seines Teams legt. Dies ist in jeder Hinsicht beispielhaft. Die Jury versteht die Preisverleihung auch als Ermunterung für andere Entscheidungsträger, in ihren Bereichen neue, unkonventionelle Wege zu gehen, damit das Gesundheitswesen ein attraktiver Arbeitsplatz bleibt und auch wieder wird.
Die Jury des Vordenker-Awards:
Florian Albert, Chefredakteur Bibliomed-Verlag
Dr. med. Christian Braun, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor, Klinikum Saarbrücken
Dr. Helmut Hildebrandt, Vordenker 2022, Vorstandsvorsitzender OptiMedis AG
Stefanie Kemp, Chief Transformation Officer (CTO), Sana Kliniken
Dr. Valerie Kirchberger, Chief Medical Officer, Heartbeat Medical
Hafid Rifi, Vordenker 2023, Chief Financial Officer, Asklepios Kliniken
Strategischer Weitblick, unkonventionelles Denken, Veränderungswille, diplomatisches Geschick – der Vordenker-Award ehrt unterschiedliche Tugenden des modernen Medizinmanagers. Ausgezeichnet werdenPersönlichkeiten aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft, die mit innovativen Ideen und Projekten ein Vorbild für die Verbesserung von Qualität und Produktivität der Versorgung sind. Der Preisträger vereint persönliches Engagement, vorausdenkende Kraft und soziale Verantwortung. Er erhält ein Kunstwerk, das als Unikat in Auftrag gegeben wird. Der Award wird im Rahmen der Networking Night auf dem DRG|FORUM verliehen.