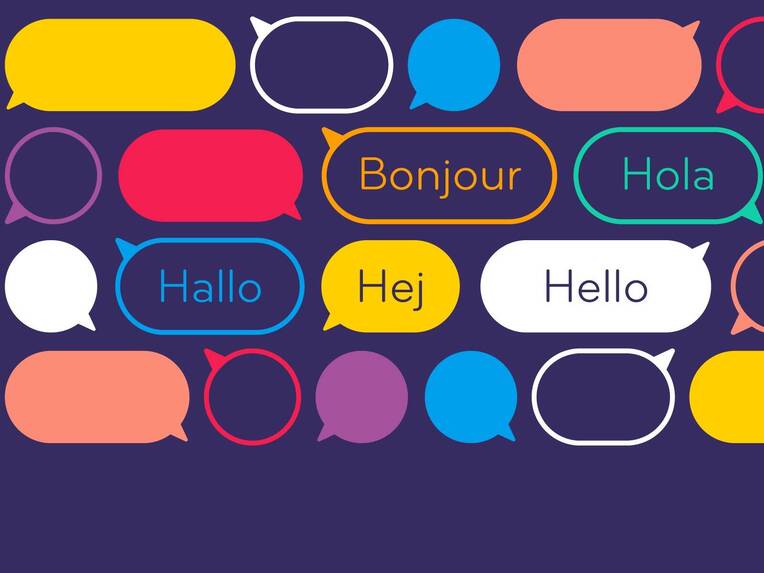Sprachbarrieren aufheben, Missverständnisse vermeiden – mehrere Kliniken haben einen digitalen Übersetzer in der Kommunikation mit nichtdeutschsprachigen Patient:innen erprobt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz der Geräte die Kommunikation verbessert. Wie bei anderen Technologien ist der nachhaltige Zugang aber entscheidend für langfristige Mehrwerte in den klinischen Abläufen.
Eine Frau mit vietnamesischem Hintergrund kommt mit starken Bauchschmerzen in die Notaufnahme. Da sie kaum Deutsch spricht, übernimmt ihre Tochter die Übersetzung. Aus Angst, etwas falsch zu formulieren, lässt die Tochter jedoch wichtige Details aus. So erwähnt sie beispielsweise nicht, dass ihre Mutter regelmäßig bestimmte Medikamente einnimmt. Diese fehlende Information erschwert die Diagnose und verzögert den Behandlungsbeginn, da die Ärztin mögliche Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen nicht sofort in Betracht zieht.
Solche Situationen sind in deutschen Krankenhäusern keine Ausnahme. Ärzt:innen und Pflegekräfte treffen immer häufiger auf Patient:innen, die kaum oder kein Deutsch sprechen. Das macht die Verständigung im medizinischen Alltag schwierig. Besonders für die Patient:innen selbst kann das zum Problem werden: Sie müssen ihre Symptome schildern, Diagnosen verstehen und Medikamente richtig einnehmen – doch ohne eine gemeinsame Sprache entstehen leicht Missverständnisse. Diese erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Fehldiagnosen und falsche Behandlungen. Studien zeigen, dass Menschen mit Sprachbarrieren medizinische Hilfe häufiger erst spät in Anspruch nehmen, was zu schwereren Krankheitsverläufen und komplizierteren Behandlungen führen kann.
Improvisierte Übersetzungen im Klinikalltag
Um diese Sprachhürden zu überwinden, greifen viele Kliniken zu improvisierten Lösungen.
[...]
Sie wollen den Artikel vollständig lesen und sind schon Abonnent?
Einloggen und weiterlesen
Sie sind noch kein Abonnent?
Jetzt Abo abschließen und unbegrenzt f&w und BibliomedManager.de nutzen