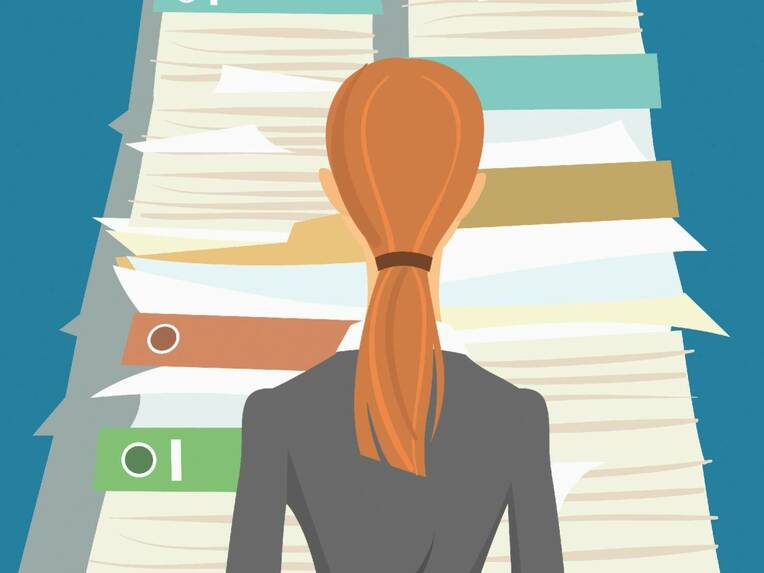Mit dem Instrument der Strukturprüfung gibt es seit 2021 einen neuen hochbürokratischen Moloch, der frei werdende personelle Ressourcen "spielend verschlingt", meint René Holm von der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling (DGfM).
Immer wieder stößt man beim Lesen von – gerade auch höchstrichterlichen – Urteilen auf den Grundtenor, es sei in ständiger Rechtsprechung anerkannt, dass die Vertragsbeziehungen zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen in partnerschaftlicher Weise zu gegenseitiger Rücksichtnahme nach dem Grundsatz von Treu und Glauben verpflichten, schließlich würde es sich um Sozialpartner handeln. Dies führt gerade aus Sicht von Krankenhäusern häufig zu Erstaunen, denn das Erleben in der Praxis ist regelmäßig ein anderes. Potenziert wird das Erstaunen dann noch durch die wiederholte Floskel der Politik und Gesundheitsverwaltungen vom Bürokratieabbau – auch hier gibt es keine Übereinstimmung mit der erlebten Realität.
Die Frage nach Treu und Glauben
Wüsste man es nicht besser, könnte öffentlich der Eindruck entstehen, die Mitarbeiter in den Krankenhäusern wollten sich nur zulasten der Krankenkassen bereichern, und schaute man ihnen nicht genauestens auf die Finger, wäre die Qualität der Behandlungen erbärmlich. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass es gerade die Mediziner waren, die schon seit der Antike ständig höchste ethische und qualitative Ansprüche an die Behandlung sowie Weitergabe der Erfahrungen gestellt haben. Auch die Pflege sowie Therapeuten legen höchstes Augenmerk auf eine bestmögliche Versorgung der Patienten und stellen auf aktuellste Erkenntnisse ihrer Berufsgruppen ab.
Dieses Selbstverständnis und der eigene Anspruch, der durch eine Vielzahl eigener Qualitätsregularien gesichert ist, werden den in den Krankenhäusern tätigen Berufsgruppen durch externe Vorgaben zunehmend abgesprochen. Die tägliche Arbeit wird durch externe Vorgaben durch Politik und Verwaltung (inklusive der Krankenkassen) in immer engere Korsetts gezwängt, die den Beteiligten die Luft zum Atmen, vor allem aber auch immer mehr den Spaß an der Arbeit nimmt. Mitarbeiter der patientennahen Berufsgruppen haben in der Regel ihren Beruf ergriffen, um am Menschen zu arbeiten, ihm zu helfen, seine Leiden zu lindern, auch ein tröstendes Wort zu sprechen, mal die Hand halten zu können. Hätten sie ihre Berufung darin gefunden, ausufernde Begründungen für jede einzelne ihrer Tätigkeiten zu dokumentieren, wären sie sicher eher in den juristischen Dienst gegangen oder Schriftsteller geworden.
Immer weniger Menschen sind bereit, unter diesen Umständen in den patientennahen Berufsgruppen zu arbeiten. Es ist nicht vordergründig die Bezahlung, die Menschen veranlasst, aus der Patientenbehandlung und -versorgung auszusteigen, sondern es sind unter anderem die genannten Rahmenbedingungen, die den Mitarbeitern die Freude an der Arbeit mit den Patienten verderben.
Die Strukturprüfungen sind ein gutes Beispiel, das man hierzu aufführen kann. In die nachfolgende Betrachtung sind Erfahrungen aus Krankenhäusern, insbesondere im Raum Berlin-Brandenburg, eingeflossen.
Instrument zum Abbau von Bürokratie
Strukturprüfungen wurden im Rahmen des MDK-Reformgesetzes ab dem Jahr 2021 in den Krankenhäusern eingeführt. Sie sollten die Versorgungsqualität im Gesundheitswesen verbessern und den Aufwand für die Einzelfallprüfungen durch den Medizinischen Dienst reduzieren. Der Aufwand für die Einzelfallprüfungen konnte auf dem Boden des MDK-Reformgesetzes tatsächlich reduziert werden, jedoch war der Effekt vordergründig auf die Einführung von Obergrenzen für die Anzahl der Einzelfallprüfungen zurückzuführen und zudem auch auf die Umstellung der Prüfungen weg vom schriftlichen Verfahren hin zu mündlichen Fallgesprächen des Medizinischen Dienstes mit Prüfung der Dokumentation vor Ort in den Kliniken, was zu einer deutlichen Reduktion des Aufwandes sowie Fehlerreduktion sowohl für die Gutachter als auch für die Krankenhäuser geführt hat.
Stattdessen wurde mit dem Instrument der Strukturprüfung ein neuer hochbürokratischer Moloch eingeführt, der frei werdende personelle Ressourcen spielend verschlingt. Es gibt Stimmen, die sprechen von einer großen „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ sowohl beim Medizinischen Dienst als auch in den Krankenhäusern. Die Krankenhäuser müssen die ohnehin knappen personellen Ressourcen für die Vorbereitung und Durchführung der Strukturprüfungen aufwenden. Man kann hier auch keine unerfahrenen Kräfte einsetzen, denn schon kleinste Fehler oder Versäumnisse werden bestraft. Im schlimmsten Fall darf das Krankenhaus erbrachte Leistungen nicht mehr abrechnen, obwohl sie seinem Versorgungsauftrag entsprechen und im Landeskrankenhausplan enthalten sind.
Verbesserung der Versorgungsqualität
Das gern vorgetragene Argument, die Strukturprüfungen würden die Versorgungsqualität verbessern, wird durch ständige Wiederholung desselben Arguments auch nicht wahrer. Hier stellt sich zuerst – wie so oft – die Definitionsfrage: Was ist mit Versorgungsqualität gemeint? Wenn man damit meint, dass sichergestellt wird, dass die Mindestmerkmale zur Abrechnung der Leistungen eingehalten werden, dann ist das Argument durchaus berechtigt, denn die Mindestmerkmale werden bei den Strukturprüfungen akribisch und exzessiv geprüft. Legt man jedoch die Maßstäbe eines Patienten an seine Versorgung oder auch andere medizinische Kriterien zugrunde, wäre durchaus vorstellbar, dass beispielsweise eine fehlende Facharzturkunde das Behandlungsergebnis nicht zwingend schmälern muss – umgekehrt die Versorgungsqualität durch ihr Vorliegen nicht zwingend steigt. Dass es auch nicht wirklich um die Qualität der Behandlung für den Versicherten geht, kann man schon allein daran erkennen, dass es Kliniken, die die Strukturmerkmale nicht erfüllen (oder bei denen eine einzelne Unterschrift in der Leistungsdokumentation fehlt), nicht verboten ist, die Leistungen zu erbringen. Die Krankenkasse muss die erbrachte Leistung nur nicht bezahlen.
Die Krankenhäuser und der Medizinische Dienst müssen nun die bürokratische Suppe, die die Politik und die Gesundheitsverwaltung ihnen eingebrockt haben, auslöffeln. Der Medizinische Dienst hat dabei die durchaus komfortable Situation, dass er die Durchführungsregeln selbst bestimmen und sich die selbst bestimmten Belege liefern lassen darf. Das Krankenhaus hingegen muss liefern, was von ihm gefordert wird. Anfangs war der Medizinische Dienst mit seinen Anforderungen zu weit über das Ziel hinausgeschossen, sodass er die erlassenen Kriterien der ersten StrOPS-Richtlinie korrigieren musste. Es gab zudem Bemühungen der Kliniken, Datenschutzbeauftragte ins Boot zu holen, da zum Beispiel das Vorlegen persönlicher Dokumente wie Facharzturkunden, Arbeitszeugnisse oder sogar Heiratsurkunden von Mitarbeitern den Krankenhäusern zu weit ging. Aber selbst die Datenschutzbeauftragten hatten keine Handhabe gegen das Gesetz beziehungsweise seine Durchführungsbestimmungen.
Prüfungen aufwendig und kleinteilig
An dieser Stelle ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass die örtliche Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern und dem Medizinischen Dienst als stets freundlich und kooperativ zu bezeichnen ist. Sei es auf organisatorischer Ebene zur Beantragung und Vereinbarung der Termine als auch bei der Begehung vor Ort.
Aufkommende Konflikte wurden von den geschulten Mitarbeitern des Medizinischen Dienstes stets dadurch gelöst, dass auf die notwendige Einhaltung der Vorgaben abgestellt wurde. „Ich kann Sie verstehen, aber ich muss die Vorgaben abarbeiten und den Beleg mitnehmen, sonst bekomme ich Ärger“, hieß es. Schwierigkeiten entstanden in Einzelfällen durch Terminsachen in Abwesenheitszeiten, wenn trotzdem keine offizielle Fristverlängerung eingeräumt wurde. Auch kam es anfänglich zu Problemen bei der Nutzung des Portals, wenn die hochgeladenen Dokumente des Krankenhauses vom Medizinischen Dienst dennoch mit letzter Frist mit „Nur noch drei Werktage verbleiben!“ angemahnt wurden. Es ist dennoch positiv anzumerken, dass der Medizinische Dienst hier diese Erinnerungsfunktion zum Fristablauf als Service vorhält.
Der örtliche Medizinische Dienst hat auf die exzessiv kleinteiligen Prüfungsvorgaben keinen Einfluss. Gerade diese sind es, die bei den Häusern den großen Aufwand bewirken. Belege sind redundant zu erbringen. Werden in demselben Haus mehrere Strukturprüfungen beantragt, müssen trotz identischen Strukturbogens alle Unterlagen mehrfach ins Portal geladen werden. Es ist zudem schwer verständlich, warum die Vorlage einer Approbation beziehungsweise Facharzturkunde zusätzlich zur Urkunde über die Erlangung einer Zusatzbezeichnung erforderlich ist, wenn die Zusatzbezeichnung ohne das Vorliegen gar nicht erlangt werden kann. Dies hat doch dann die Ärztekammer bereits geprüft, bevor überhaupt die Prüfung zur Zusatzbezeichnung abgelegt werden konnte.
Es ist zudem sehr übergriffig, wenn die Vorlage von persönlichen Dienstplänen und von Heiratsurkunden (bei Namenswechseln) verlangt wird oder die Vorlage von Arbeitszeugnissen, um Berufserfahrung zu hinterfragen. Es handelt sich schließlich um persönliche Dokumente von Mitarbeitern. Diese werden beim Medizinischen Dienst auf Servern (oder in irgendwelchen Rechenzentren oder Clouds) gespeichert, ohne dass dies zwingend notwendig wäre. Sicherlich wird der Medizinische Dienst alle sinnvollen Vorkehrungen gegen Datendiebstahl treffen. Ein vollständiger Schutz bestünde jedoch ganz einfach in einer Nichtspeicherung der Daten. Es ist zu konstatieren, dass wir in einer seltsamen Zeit leben: Nicht nur dass die Krankenkassen ihren „Sozialpartnern“, den Krankenhäusern, misstrauen, sondern inzwischen hinterfragen und reklamieren sie auch den Medizinischen Dienst. Es gab Zeiten, da nannten die Krankenkassen ihre Gutachter noch „Vertrauensärzte“. Mit dem Namenswechsel sind auch diese Zeiten längst passé.
Es bleibt festzustellen, dass die Strukturprüfungen für die Häuser einen großen Aufwand darstellen und symptomatisch sind für das Fehlen von Treu und Glauben. Die Prüfungen sind sehr kleinteilig und übergriffig auf persönliche Informationen, jedoch gestaltet sich die Zusammenarbeit auf der unteren Ebene als freundlich. Anfangsschwierigkeiten wurden und werden kontinuierlich verbessert.
Schon kleinste Fehler oder Versäumnisse werden bestraft.
Im schlimmsten Fall darf das Krankenhaus erbrachte Leistungen nicht mehr abrechnen, obwohl sie seinem Versorgungsauftrag entsprechen und im Landeskrankenhausplan enthalten sind.